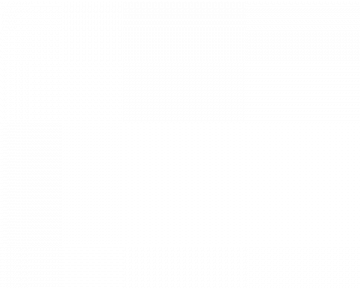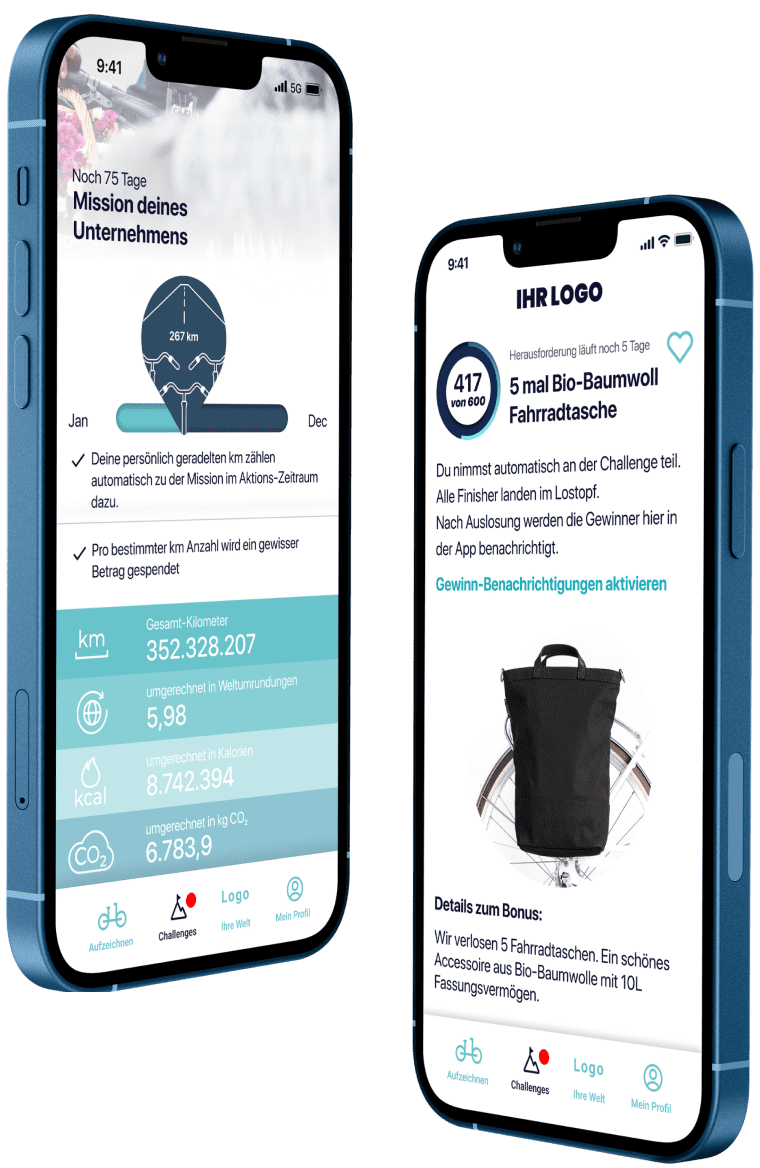Erinnerungen – eine Liebeserklärung an das Radfahren

Ich müsste um die drei Jahre alt gewesen sein, vielleicht auch vier. Meine Großeltern haben mir zu Ostern mein erstes Fahrrad geschenkt. Der Rahmen hatte ein Tigermuster, am Gepäckträger hing ein Fähnchen, die Klingel war quietschbunt, ebenso die Stützräder. Stolz wie Oskar fuhr ich damit durch die Stadt, versuchte meinen Eltern davonzufahren. Eine Zeit lang hat das gereicht, dann stand ein großer Tag an, der mein Leben verändern sollte: Die Stützräder sollten ab. Der Gedanke behagte mir ganz und gar nicht. Bei meiner ersten Fahrstunde, mit meinem Vater im Park, habe ich mich nach den ersten Metern die ich alleine fuhr von meinem Sattel ins Gras geworfen – mit der Aussage, dass ich lernen müsse, wie man sich bei einem Unfall richtig abrollt. Ich wollte nicht auf die Sicherheit verzichten, die mir die Stützräder gaben. Doch als ich etwas mehr Vertrauen in mich selbst und das Fahrrad gewann, dass mich treu und zuverlässig trug, merkte ich, wie einfach das Radfahren doch war. Das Fahrrad und ich wurden gute Freunde.
Tag für Tag radelte ich von nun an zum Kindergarten, später zur Schule. Anfangs an der Seite meiner Mutter, irgendwann, nachdem sie sich sicher war, dass ich jede Ampel und gefährliche Stelle kannte, durfte ich alleine fahren. Da spürte ich zum ersten Mal, was ich in früheren Jahren nur erahnen konnte: Fahrradfahren ist ein Stück Freiheit.
Das Fahrrad kam jetzt fast überall zum Einsatz. Mit meinen Freunden probierte ich in unserer Sackgasse besonders waghalsige Bremsmanöver aus, brachten mit quietschenden Reifen (sehr zum Leidwesen dieser (und zum Leidwesen unserer Nachbarn)) Gummi auf den Asphalt, den wir uns von den Autos erkämpft hatten. Wir fühlten uns wie Forscher und Entdecker, während wir bei einem Ausflug mit unseren Eltern versuchten durch den unbefestigten Wald, abseits der Wege zu fahren. Manchmal reichte es jedoch, wenn uns das Rad zur nächsten Eisdiele brachte, wo wir uns einen Eisbecher besorgten um uns schleckend und Game-Boy spielend in eine ruhige Ecke zu verziehen.
Als ich älter wurde, perfektionierte ich meinen Schulweg. Ich kannte jede Ampelschaltung, wusste wie schnell ich auf einzelnen Streckenabschnitten fahren musste um möglichst selten anzuhalten – und um auf die Minute pünktlich zum Unterricht zu erscheinen (oder zum Fußballspielen vor dem Unterricht). Nach der Schule trug mich mein Fahrrad wie immer zuverlässig nach Hause oder zu Freunden, ohne fragen zu müssen, ob und wann meine Eltern Zeit hatten mich abzuholen.
Die Treffen am Nachmittag wurden zu Grillabenden am Rhein, bei denen ein Dutzend Räder kreuz und quer verstreut im Gras und Sand lagen. Mein Rad sah Sonnenuntergänge und manches Mal die Sonne wieder aufgehen. Häufig ächzte es, wenn jemand auf dem Gepäckträger saß, doch mein Fahrrad verzieh es mir. Es trug mich zu den Abi-Prüfungen und zum Abholen des Abi-Zeugnisses. Es brachte mich sicher zum ersten Abendessen bei den Eltern meiner Freundin, obwohl ich wacklige Knie hatte.
Nach der Schulzeit jedoch änderte sich das Verhältnis zwischen mir und meinem Rad.
Heute ist mein Fahrrad zu einem Alltagsgegenstand geworden. Es bringt mich zum Sport, in die Uni, zur Arbeit, zum Einkaufen. Es ist nichts besonders mehr, sich auf den Sattel zu schwingen. Das Fahrrad wurde zum Verkehrsmittel wie jedes andere. Manchmal jedoch erinnere ich mich daran, dass es eben kein Verkehrsmittel ist wie jedes andere. Wenn ich an meiner alten Schule vorbeifahre zum Beispiel. Oder wenn ich den Weg zu meinen Freunden fahre, den ich ich schon vor Jahren gefahren bin. Wenn mir am Rhein der Wind um die Nase weht und die Sonne meine Haut wärmt. Dann bekomme ich ein Stück dieser Leichtigkeit zurück. Die Leichtigkeit einer Zeit, als eine meiner größten Sorge war, ob es morgen regnen würde.
Dann erinnere ich mich daran, wie sehr ich das Radfahren liebe.